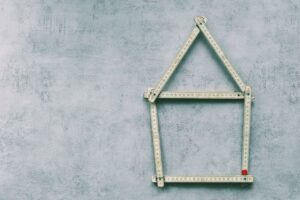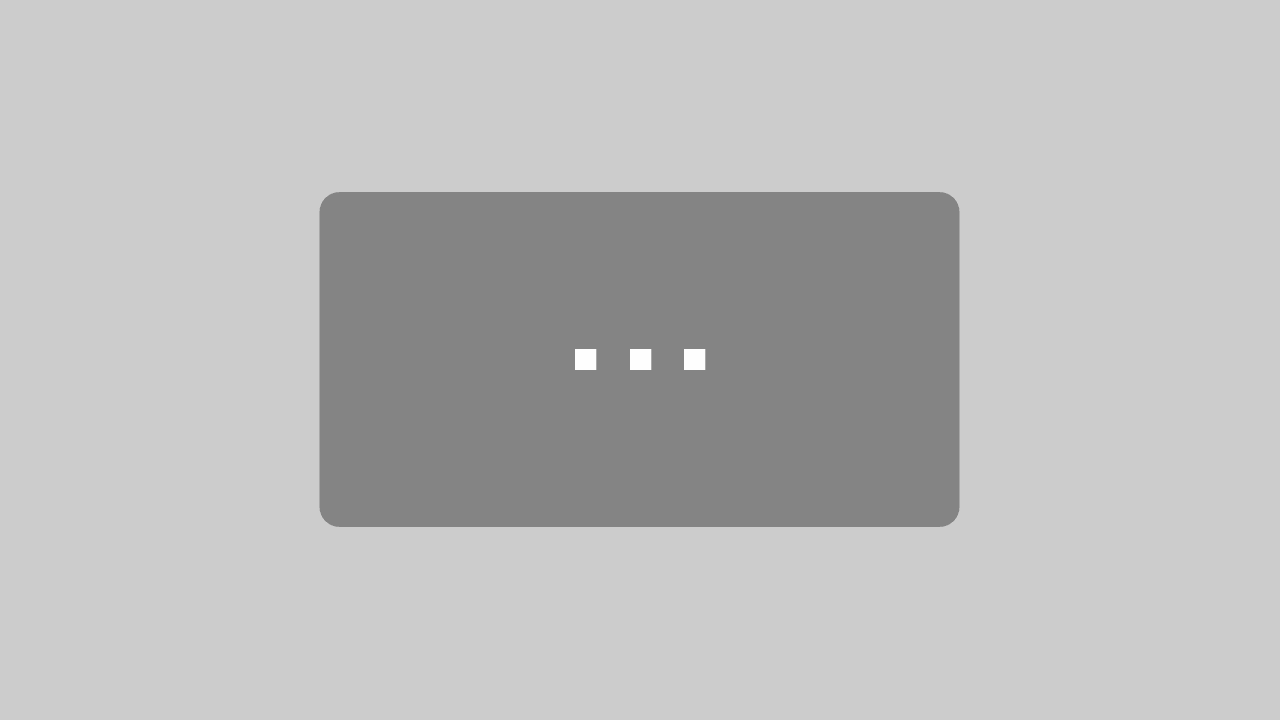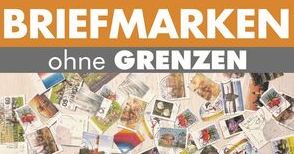Bidens Kampagne ist am Ende. Die TV-Debatte vom 27. Juni markierte den Anfang vom Ende. Erst durch sie wurde den Amerikanern klar, dass sie von einem senilen Mann regiert werden.
Am Sonntag hat US-Präsident Joe Biden mit einer Mitteilung über X verkündet, doch nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren zu wollen. Dieser Schritt kam nicht mehr überraschend. Denn nach seinem schwachen Auftritt in der CNN-Debatte vom 27. Juni gegen Donald Trump waren Rufe innerhalb der demokratischen Partei nach einem Rückzug immer lauter und der Druck, aufzugeben, immer größer geworden. Am Ende zu groß. Jetzt wissen wir: Die CNN-Debatte vom 27. Juni war der Anfang vom Ende seiner Bemühungen um eine Wiederwahl.
Die Debatte vom 27. Juni
Biden hatte in der CNN-Debatte alt und gebrechlich gewirkt, Dinge durcheinandergeworfen, gestammelt und teilweise Probleme, seine Sätze zu vollenden. Linke US-Sender wie CNN und MSNBC und demokratische Parteistrategen reagierten mit Entsetzen auf den blutleeren Auftritt des designierten Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten. Innerhalb der demokratischen Partei machte sich Panik breit. CNN-Kommentator und Ex-Obama-Berater Van Jones bezeichnete den Abend als „schmerzhaft“. Das Editorial Board der renommierten „New York Times“ rief Biden bereits am Tag nach der Debatte zum Rückzug auf.
Doch wie konnte es passieren, dass eine einzige Debatte die Wahlkampagne des mächtigsten Mannes der Welt innerhalb von nur dreieinhalb Wochen zum Einsturz bringt? Hatten nicht über 14 Millionen Wähler Biden in den „Primaries“ ihre Stimme gegeben? Hatte Biden die Vorwahlen der US-Demokraten nicht souverän mit einem Stimmenanteil von 87 % gewonnen?
Nicht bloß eine schlechte Nacht
Der CNN-Debattenauftritt war nicht bloß eine „bad debate night“, wie Ex-US-Präsident Barack Obama behauptete und auch Joe Biden zu versichern suchte. Er warf bei den über 50 Millionen Amerikanern an den Bildschirmen vielmehr die Frage auf, ob Biden körperlich und geistig überhaupt in der Lage ist, das Amt des US-Präsidenten angemessen auszuüben. Nach der Debatte lautete die Antwort von 72 % der amerikanischen Wähler auf diese Frage: nein. Sogar CNN-Arzt Dr. Sanjay Gupta rief den US-Staats- und Regierungschef dazu auf, sich einem kognitiven Test zu unterziehen.
Hatte sich Bidens Gesundheitszustand also plötzlich verschlechtert? Hatte er etwa einen Schlaganfall oder ähnliches erlitten? Oder war sein Auftritt mit Übermüdung oder einem Schnupfen zu erklären? Oder hatten Joe Biden und das Weiße Haus den wahren Fitnesszustand des „Commander-in-chief“ etwa über Monate und Jahre so geschickt verschleiert, dass Bidens Probleme für die Medien und die zahlreichen Washington-Korrespondenten nicht erkennbar waren? So behauptete etwa der US-Soziologe Jeffrey Alexander, bei Medien wie der New York Times scheine „man das Gefühl zu haben, in den letzten Monaten vom Weißen Haus quasi hinters Licht geführt worden zu sein.“
Doch die Antwort auf all die genannten Fragen lautet: Nein, nein und wieder nein. Denn weder hatte sich Bidens Zustand Ende Juni plötzlich signifikant verschlechtert noch war sein schlechter körperlicher und geistiger Zustand zuvor nicht erkennbar gewesen. So stellte beispielsweise Hollywood-Schauspieler George Clooney in einem New York Times-Beitrag vom 10. Juli klar: Biden sei müde gewesen und habe vielleicht eine Erkältung gehabt. Aber der Joe Biden im CNN-Duell sei nicht der Joe Biden von 2010 und nicht einmal der Joe Biden von 2020, sondern derselbe Joe Biden gewesen, den er wenige Wochen vor der Debatte bei einer von ihm veranstalteten Spendengala in Los Angeles erlebt habe. Die Parteiführer der Demokraten müssten daher „aufhören, uns zu erzählen, dass 51 Millionen Menschen nicht gesehen haben, was wir gesehen haben“.
Bidens Auftritt keine Überraschung
Daher war Bidens Debatten-Performance für all diejenigen, die in den letzten Monaten und Jahren Auftritte des US-Präsidenten verfolgt hatten, keineswegs überraschend, sondern vielmehr die Bestätigung eines längst gewonnenen Eindrucks: Dass Biden nämlich weder körperlich noch geistig die Voraussetzungen mitbringt, die für das Amt des US-Präsidenten erforderlich sind. Jedem, der sehen und hören kann, musste sich dieser Eindruck aufdrängen. Das Internet und die sozialen Medien sind schließlich voll von Beiträgen, in denen Biden Probleme hat, Sätze zu vollenden, aus unerklärlichen Gründen Schwierigkeiten hat, den Weg von einem Podium zu finden, beispielsweise behauptet, sein an Krebs verstorbener Sohn Beau sei im Irak gefallen, oder Probleme hat, richtig vom Teleprompter abzulesen („Four more years. Pause.“).
In der „Dokumentenaffäre“ hatte Sonderermittler Robert Hur bereits Anfang des Jahres von einer Anklage abgesehen, da Biden sich einer Jury wohl – wie auch ihm gegenüber – als „wohlmeinender, älterer Mann mit schlechtem Gedächtnis“ präsentieren würde.
Vergleiche mit Interviews, Reden und Auftritten aus dem letzten Präsidentschaftswahlkampf oder dem ersten Jahr seiner Präsidentschaft zeigen unübersehbar, wie sich der körperliche und geistige Zustand des nun 81-Jährigen verschlechtert hat. Dabei hatte es bereits von vier Jahren – selbst innerhalb der demokratischen Partei – Zweifel an Bidens geistiger Fitness gegeben.
Mit Fake News gegen „Fake News“
Das Weiße Haus und Vertreter vieler Mainstream-Medien diskreditierten jedoch über Monate berechtigte Zweifel an Bidens körperlicher und geistiger Eignung für das Amt als rechte Propaganda und Fake News. Ein Kurzvideo von der bereits erwähnten Clooney-Spendengala, auf dem Biden versteift wirkt und von Barack Obama von der Bühne geführt wird, wurde vom Weißen Haus als „in böser Absicht manipuliert“ bezeichnet und als „Desinformation“ abgetan. Noch weniger als eine Woche vor dem für Biden desaströsen TV-Duell versuchte die New York Times die Zweifel an Bidens Eignung zu zerstreuen, indem sie einschlägige Videos als „irreführend“ einstufte. Weniger als eine Woche nach dem Duell wurden die Vorfälle, die Bidens Eignung in Frage stellten, von derselben New York Times (wenn auch von einem anderen Autor) dann plötzlich gänzlich anders eingeordnet: Bidens Ausfälle seien „immer häufiger und besorgniserregender“.
Ein Video vom G 7-Gipfel im Juni, auf dem Biden desorientiert und verwirrt wirkt, wurde von Elmar Theveßen, dem Leiter des ZDF-Studios in Washington, fälschlicherweise als „billige Fälschung“ deklariert, was „die offiziellen Fernsehbilder“ angeblich belegen würden. „Rechte Büchsenspanner“ hätten lediglich einen falschen Kamerawinkel gewählt, Joe Biden sei „gar nicht verwirrt“ gewesen, versicherte Theveßen. Ebenjener Theveßen behauptete zudem über Monate hinweg, Joe Biden sei „geistig topfit“ und könne seine Ansichten in gestochen scharfen Sätzen herüberbringen.
Joe Scarborough, Gastgeber der MSNBC-Sendung „Morning Joe“, verkündete noch vor wenigen Monaten: Er kenne Biden seit vielen Jahren und – auch wenn manche mit der Wahrheit nicht umgehen könnten – sei der jetzige Biden intellektuell und analytisch der beste Biden „ever“.
Aufgrund dieser irreführenden und die wahren Begebenheiten verschleiernden Berichterstattung war der Knall dann umso größer, als sich Biden mehrere Monate nach seiner letzten Solo-Pressekonferenz in der CNN-Debatte neunzig Minuten lang und ohne Teleprompter einem Millionenpublikum präsentierte – und die amerikanischen Wähler sahen, was sie sahen. Die Darstellung vom geistig fitten Biden ließ sich nicht mehr aufrechterhalten, wollten die entsprechenden Medien nicht gänzlich ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Viele Mainstream-Medien ließen Biden daher fallen und vollzogen in ihrer Berichterstattung über Bidens Gesundheitszustand eine 180-Grad-Wende. Plötzlich wurde beispielsweise beim US-Sender NBC sogar mit einem Experten über Anzeichen einer möglichen Parkinson-Erkrankung Bidens diskutiert – was kurz zuvor noch undenkbar gewesen wäre.
Ohne sachliche und wahrheitsgetreue Berichterstattung kein Vertrauen
Für Jill Abramson, frühere Chefredakteurin der New York Times, ist es „einfach erstaunlich, dass das ganze Land, einschließlich der erfahrensten Reporter, von der hässlichen und schmerzhaften Realität von Bidens Debattenauftritt so schockiert war wie alle anderen“.
Doch worauf ist dieses kolossale Medienversagen zurückzuführen? Warum wurde Bidens Eignung nicht bereits vor der CNN-Debatte vom 27. Juni in Frage gestellt? Auch ZDF-Moderator Markus Lanz fragt sich, wie es sein kann, dass viele „White House“-Korrespondenten, „die alle so nah dran sind an diesem Präsidenten, das nicht schreiben?“ Lanz geht davon aus, dass es „ein nicht abgesprochenes, nicht offizielles Abkommen“ gegeben habe. Er mutmaßt, man habe das Alter Bidens nicht zum Thema machen wollen, weil man nicht diskriminieren wollte. Doch Jill Abramson hat einen anderen Verdacht: Sie befürchtet, viele Journalisten hätten aus Angst, „beschuldigt zu werden, bei der Wahl von Donald Trump mitgeholfen zu haben“, nicht über Bidens Verfall berichtet.
Die Aufgabe von Medien ist es, sachlich, ausgewogen und wahrheitsgetreu über nachrichtenrelevante Ereignisse zu informieren, damit sich Bürger auf dieser Grundlage eine fundierte Meinung bilden können. Doch wer die Medienberichterstattung aufmerksam verfolgt, dem fällt auf, dass viel zu oft nicht sachlich berichtet wird, sondern dass es nicht selten hauptsächlich darum geht, bestimmte Narrative zu verbreiten. Was die US-Berichterstattung anbelangt ist das Narrativ klar: Die Demokraten sind die Guten und die Republikaner (und insbesondere Trump) sind die Bösen. Viele Journalisten treibt ihr Idealismus an; sie wollen ihren Beitrag zu einer besseren Welt liefern. Sie sehen in der Verhinderung des Wahlsiegs von Donald Trump – angesichts der Gefahren, die von ihm ausgehen, nicht unbegründet – eine gute Sache. Und da eine Berichterstattung über Zweifel an der körperlichen und geistigen Eignung Bidens Trump in die Hände gespielt hätte, wurden entsprechende Anzeichen, die sich über Monate und Jahre zeigten, abgestritten.
Parteilichkeit führt zu Fehlleistungen
Doch ein solcher Ansatz ist gefährlich. Denn er untergräbt das Vertrauen in die mediale Berichterstattung. „Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache“, stellte der ehemalige Tagesthemen-Moderator Hanns Joachim Friedrichs einst fest. Spiegel-Journalist René Pfister resümierte daher in seinem Buch „Ein falsches Wort“ treffend: „Glaubwürdigkeit von Journalismus lebt von kritischer Distanz“ und „Parteilichkeit führt im Journalismus unweigerlich zu Fehlleistungen.“
Eine solche Fehlleistung war die Beteiligung vieler Journalisten an der Verschleierung des tatsächlichen Fitnesszustandes von Joe Biden. Die Siegchancen der Demokraten im Kampf um das Weiße Haus sind aufgrund des späten Ausstiegs von Joe Biden stark gemindert; Donald Trump gilt derzeit nämlich als Favorit. Hätten die Medien früher über Bidens körperlichen und geistigen Verfall berichtet und hätte der US-Präsident früher seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt, hätten die Demokraten mehr Zeit gehabt, einen starken Nachfolger oder eine starke Nachfolgerin aufzubauen.
Und so droht ausgerechnet wegen der beschriebenen journalistischen Fehlleistung der damit verfolgte Zweck auch noch fehlzuschlagen. Dass ausgerechnet ein Journalist wie Elmar Theveßen, der an dieser Fehlleistung beteiligt war, zu den aktuellen Preisträgern des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises gehört, dessen Motto das oben genannte Zitat seines Namensgebers ist, sagt viel über den Zustand des Journalismus in Deutschland aus.