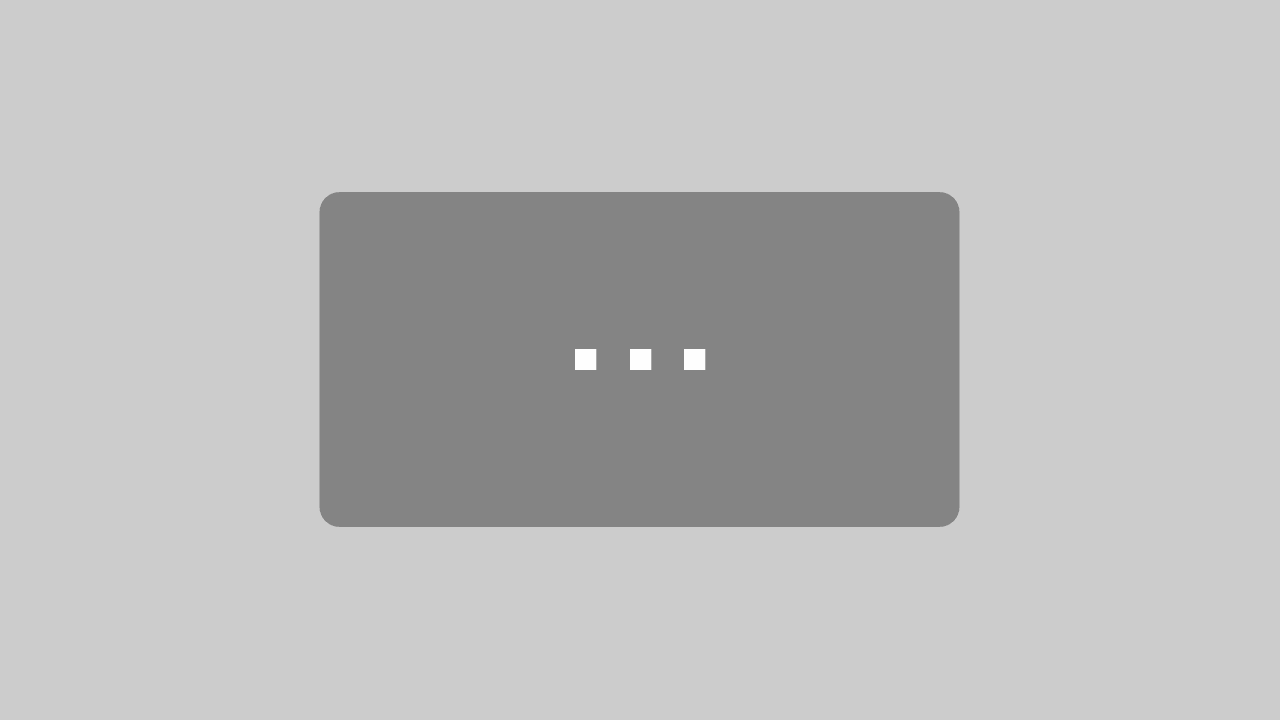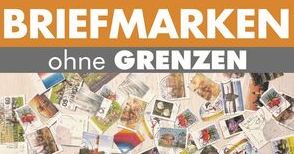Haben Sie schon mal etwas von Richard Dawkins gehört? Mit Büchern wie „Der Gotteswahn“ (2006) wurde der britische Evolutionsbiologe zu einem der prominentesten Atheisten der Welt. Im vergangenen Jahr sorgte Dawkins vor Ostern mit einem Bekenntnis für Aufsehen: Er sei zwar kein gläubiger Christ, aber ein „Kulturchrist“.
Großbritannien sei kulturell ein christliches Land, sagte Dawkins. Er liebe Kirchen- und Weihnachtslieder und fühle sich im christlichen Ethos zu Hause. Er sei zwar froh darüber, dass die Zahl der gläubigen Christen in Großbritannien zurückgehe, aber er wäre „nicht glücklich, wenn wir alle unsere Kathedralen und unsere wunderschönen Pfarrkirchen verlieren würden“. Der Engländer fände es zudem äußerst schädlich, wenn wir das Christentum durch eine andere Religion ersetzen würden.
Das Schöne
Der mittlerweile 84-jährige Brite hebt somit Aspekte des Christentums hervor, die auch er als kämpferischer Atheist positiv findet. Er sieht etwas Gutes in den christlichen Werten und ihm gefällt die Schönheit christlicher Kirchen und Lieder.
Und es fällt tatsächlich nicht sehr schwer, die Schönheit, die das Christentum hervorgebracht hat, zu erkennen. Viele der großartigsten und beeindruckendsten Kunstwerke der Welt gäbe es beispielsweise ohne das Christentum nicht. Die tausenden Kirchen und Kathedralen dieser Welt – obwohl vielmals bereits vor Jahrhunderten errichtet – lassen uns heute noch ins Staunen geraten. Millionen von Menschen bewundern Jahr für Jahr die gleichermaßen gewaltige wie elegant-filigrane gotische Westfassade des Kölner Doms, den weltberühmten Schiefen Turm von Pisa, Gaudís meisterhafte Sagrada Família in Barcelona oder wie sich Michelangelos geniale Renaissance-Kuppel über dem Petrusgrab und der Ewigen Stadt erhebt.
Die größten Komponisten aller Zeiten inspirierte das Christentum zu Meisterleistungen. Man denke nur an Mozarts virtuoses „Requiem“, Bachs gefühlvolles „Jesus bleibet meine Freude“, Vivaldis stimmungsvolles „Gloria in excelsis deo“ oder Händels kraftvolles „Messias“. Kirchenlieder wie „Großer Gott, wir loben dich“ oder „Amazing Grace“ erzeugen Gänsehaut-Momente. Und wie könnte man weihnachtliche Stimmung besser und schöner ausdrücken als mit Weihnachtsliedern wie „Stille Nacht, heilige Nacht“, „The First Noel“ oder „Adeste Fideles“?
Das Gute
Aber das Christentum hat nicht nur Schönheit, sondern auch Gutes hervorgebracht. Auch wenn die westliche Welt mit Jerusalem, Athen und Rom mehrere Wurzeln hat, ist der christliche Einfluss doch unübersehbar: Wir leben im Jahr 2025 nach Christus, feiern an Ostern seine Auferstehung, Kathedralen und Kirchen prägen bis heute das Bild der meisten Städte und Dörfer in Europa. Ohne das Christentum würden wir nicht in der Welt leben, in der wir leben. Nach dem Bestseller-Autor Manfred Lütz ist es „das Christentum, das die europäische Kultur hervorgebracht hat“.
Der US-amerikanische Religionssoziologe Rodney Stark (der sich als Agnostiker – und wie Dawkins – als „kulturellen Christen“ bezeichnete) sieht in dem Siegeszug der Vernunft, die im christlichen Abendland auf fruchtbaren Boden fiel, den Grund für die Erfolgsgeschichte der „westlichen Welt“. So hatte der heilige Augustinus (354-430) bereits erkannt, dass Vernunft für den Glauben unverzichtbar ist und die Bibel nicht stets wörtlich zu verstehen, sondern mit Vernunft auszulegen ist. Denn die Bibel gilt zwar als „von Gott inspiriert“ (2. Timotheus 3,16), wurde aber von Menschen geschrieben. Jesus selbst hat keine Schriften hinterlassen. Christliche Theologen waren daher zur Textauslegung gezwungen. Es ist ein Grundprinzip christlicher Theologie, dass man mit der Zeit mit vernunftgeleitetem und logischem Denken ein besseres Verständnis von Gott gewinnen kann. So kam Augustinus beispielsweise zu dem Schluss, dass Astrologie falsch ist, da der Glaube an ein durch die Stellung der Sterne vorbestimmtes Schicksal nicht mit der Lehre von einem gottgegebenen freien Willen vereinbar wäre. Und während viele der frühen Christen Totalpazifisten waren, entwickelte Augustinus die Lehre vom gerechten Krieg.
Der Glaube an einen Gott als Schöpfer des Universums beförderte den Aufstieg der Wissenschaft in Europa. Naturwissenschaftlern wie Galileo Galilei (1564-1641/42), Johannes Kepler (1571-1630), René Descartes (1596-1650) und Isaac Newton (1643-1727) war gemein, dass sie an einen Schöpfergott glaubten. Und weil man annahm, Gott sei perfekt, musste auch seine Schöpfung unveränderliche Naturgesetze beinhalten, die mit gottgegebenem Verstand und Beobachtung wissenschaftlich erforscht und entdeckt werden konnten. Oder um es mit C.S. Lewis (1898-1963) zu sagen: „Die Menschen wurden wissenschaftlich, weil sie ein Gesetz in der Natur erwarteten, und sie erwarteten ein Gesetz in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten“.
Für chinesische Philosophen oder die alten Griechen und Römer, die davon ausgingen, dass das Universum bereits immer bestanden hatte, gab es hingegen keinen Grund dafür, anzunehmen, dass es in der Natur gewisse Gesetzmäßigkeiten gebe, die mit dem menschlichen Verstand erforschbar und erfassbar sind. Anzunehmen, dass unsere Welt für uns verstehbar ist, war – wie auch Albert Einstein (1879-1955) einst konstatierte – alles anderes als selbstverständlich: „Das einzig Unbegreifliche am Universum ist, dass es begreiflich ist“.
Wie Manfred Lütz schreibt, prägten das Christentum und das Gebot der Nächstenliebe (Markus 12,31) auch unser heutiges Verständnis von Toleranz: Die Römer hatten hierunter nicht das Ertragen anderer Meinungen, sondern nur das Ertragen körperlicher Mühen verstanden. Und während es bis zur Antike in jeder Kultur als selbstverständliche Pflicht der Machthaber galt, im Gemeinwohlinteresse die Verehrung der Götter zu fördern, um nicht deren Zorn auf sich zu ziehen, war der Glaube nach christlicher Auffassung – wie auch Thomas von Aquin (1225-1274) feststellte – „Sache des freien Willens“. Und auch das Mitleid ist eine christliche „Erfindung“. So wandte sich Jesus denen zu, die von den Heiden als Geschlagene ausgegrenzt wurden: Den Armen, Kranken und Schwachen. Denn „[s]elig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden“ (Matthäus 5,4) und „[w]as ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Matthäus 25,40). Und so wurden erst mit dem Christentum Institutionen wie Waisen- oder Krankenhäuser eingerichtet, für die die Griechen und Römer bis dahin nicht einmal ein Wort hatten.
Nach Rodney Stark beförderten das Christentum und seine Lehre vom freien Willen, persönlicher Schuld und Erlösung auch die „Entdeckung“ des Individualismus. Während beispielsweise Aristoteles (384-322 v. Chr.) noch meinte, dass aufgeklärte Männer ohne Sklaverei nicht die Zeit hätten, nach Weisheit zu streben, entwickelte das Christentum eine beispiellose moralische Opposition zur Sklaverei. Mit der Taufe von Sklaven erkannte das Christentum diese als Menschen und Christen an. Denn: „Da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau; denn ihr seid alle einer in Christus Jesus.“ (Galater 3,28). Mit dem 10. Jahrhundert verschwand die Sklaverei in Europa. Auch gegen den transatlantischen Sklavenhandel und die Sklaverei, die im Kolonialismus (wieder) aufkamen, bildete sich unter dem Motto „Sklaverei ist Sünde“ christlich motivierter Widerstand, der letztendlich zur Sklavenbefreiung führte. Christus wurde nämlich zur Rettung aller Menschen geboren. Die Heiligen Drei Könige, die der Legende nach das Christuskind in der Krippe besuchten, kamen von allen drei damals bekannten Kontinenten. Am Kreuz ist Christus für die Erlösung aller Menschen gestorben. Sein Missionsbefehl richtet sich an Menschen aller Völker („geht zu allen Völkern“, Matthäus 28,19).
Anders als in den Stammesreligionen, nach denen jeder Stamm seinen eigenen Gott hatte, gibt es nach jüdisch-christlichem Glauben nur einen Gott als Schöpfer der Erde und aller Menschen und Völker, wie Manfred Lütz schreibt. Der Monotheismus schaffte so die Voraussetzung für die Idee von der Gleichheit aller Menschen, auf der unser moderner demokratischer Rechtsstaat beruht. Die Geschichte von Adam und Eva verdeutlicht uns, dass es keine bevorrechtigte Abstammung bestimmter Menschen oder Völker gibt. Nach Genesis 1,27 hat Gott den Menschen als Mann und Frau nach seinem Bild (imago dei) als körperliches und geistiges Wesen mit einer unsterblichen Seele geschaffen. Dies bedeutet, dass jeder Mensch gottgewollt ist und als Person unverlierbare Würde hat. Das Tötungsverbot, das Moses auf dem Berg Sinai empfing (Exodus 20,13), gilt daher auch nicht mehr nur für Stammesgenossen, sondern universell. Aus dem Glauben an einen Schöpfergott und der imago dei-Lehre entwickelte sich im Zeitalter der Aufklärung die Idee der Menschenrechte.
Viele weitere kulturelle Errungenschaften des Christentums halten wir heute für selbstverständlich. Wer könnte sich beispielsweise eine Welt ohne Universitäten vorstellen? Dass auch die Trennung von Staat und Religion, die schon im jungen lateinischen Christentum angelegt war – „Mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt“ (Johannes 18,36), „So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“ (Matthäus 22,21) – und sich mit der Aufklärung endgültig durchsetzte, alles andere als selbstverständlich ist, zeigt beispielsweise ein Blick zu den alten Griechen oder Römern oder in die islamische Welt.
Die Anerkennung persönlicher Freiheit und von Eigentumsrechten – welche die Bibel voraussetzte („Du sollst nicht stehlen“, Exodus 20,15) und die von Kirchenvätern als natürliches Recht und gemeinwohlfördernd angesehen wurden – als auch die Trennung von Kirche und Staat sowie demokratische Herrschaftsformen in einigen italienischen Stadtstaaten führten – wie Rodney Stark detailliert darlegt – zur Entwicklung der Marktwirtschaft, die die Basis unseres heutigen Wohlstands ist.
Das Wahre?
Das Christentum hat also fraglos Schönes und Gutes hervorgebracht – was Dawkins auch anerkennt. Dies bedeutet jedoch noch nicht, dass christliche Glaubensgrundsätze auch wahr sein müssen; dies beweist beispielsweise noch nicht, dass es tatsächlich einen Gott gibt. Dawkins sagt, dass er „nur an der Wahrheit interessiert“ sei. Es ist zwar fraglich, warum es für einen Utilitaristen wie Dawkins überhaupt wichtig sein sollte, was wahr ist, da es nach einer evolutionär-biologischen, utilitaristischen Weltsicht darauf ankommt, ob etwas nützlich ist. Davon mal abgesehen, ist es aber natürlich berechtigt, sich die Frage zu stellen, ob der christliche Glaube bloß ein „notwendiges“ oder „nützliches“ Märchen (oder Unsinn – wie Dawkins auch sagt) ist oder ob in ihm auch Wahrheit steckt.
Naturwissenschaftlich beweisen lässt sich die Existenz Gottes (ebenso wie seine Nicht-Existenz) nicht. Warum? Weil Naturwissenschaften sich mit der materiellen Welt auseinandersetzen. Nach der „Urknall-Theorie“ des belgischen Priesters und Astrophysikers Georges Lemaître (1894-1966) entstanden mit dem Urknall Materie, Energie, Raum und Zeit, mit denen und deren Wechselwirkungen sich die Physik beschäftigt. Aus Materie und Energie bildeten sich danach Atome und Moleküle. Mit Atomen und Molekülen sowie ihren Reaktionen beschäftigt sich Chemie. Aus bestimmten Molekülen bildeten sich auf unserer Erde mit der Zeit Organismen, mit denen sich die Biologie beschäftigt.
Gott ist nach christlicher Vorstellung aber eine geistige und transzendente Person. „Transzendenz“ leitet sich vom lateinischen „transcedere“ ab, was „hinübersteigen, überschreiten“ bedeutet. Gott überschreitet die Grenzen der materiellen, gegenständlichen Welt, die die Naturwissenschaften untersuchen. Gott ist die Ursache des Universums – der Entstehung von Materie, Raum und Zeit. Er ist daher für uns Menschen Zeit unseres irdischen Lebens nie ganz fassbar. Auch wenn wir zahlreiche rationale Gründe für die Existenz Gottes (und auch gegen seine Existenz) finden können, geht der Glaube über das hinaus, was wir rein mit dem Verstand erfassen können.
Ist es dumm, etwas für wahr zu halten, was man nicht beweisen kann? Ist Religion sogar eine Geisteskrankheit, wie Richard Dawkins behauptet? Eine Krankheit ist ein Zustand, der vom Normalzustand negativ abweicht. Lebenserfahrung und Studien deuten jedoch darauf hin, dass religiöse Menschen eher resilienter sind und wohl auch eine höhere Lebenserwartung haben. Einen Glauben an Gott als krankhaft zu bezeichnen, ist daher nicht überzeugend.
Dawkins behauptet, dass jemand, der an einen Gott, ein „fliegendes Spaghetti-Monster“ oder ähnliche Dinge glaube, für deren Existenz die Beweislast trage. Doch zum einen muss hier keine Seite der anderen die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes beweisen – wir sind nicht vor Gericht, wo bestimmte Beweislastregeln gelten. Und zum anderen ist es auch nicht stichhaltig, den Glauben an einen Gott mit dem an ein unsichtbares Spaghetti-Monster gleichzusetzen. Es hat nämlich Gründe, warum es niemanden gibt, der an ein Spaghetti-Monster glaubt, aber Milliarden von Menschen, die an einen Schöpfergott glauben: Weil letzteres nämlich nicht irrational, sondern plausibel, logisch und sinnvoll ist.
Denn es entspricht zum einen unserer Erfahrung, dass alles Physische, was begonnen hat, zu existieren, eine Ursache hat. Auch die Existenz von Naturgesetzen sowie die hohe Komplexität und Feinabstimmung des Universums zeugen von einer Genialität und deuten daher auf eine überragende schöpferische Geisteskraft hin. Ohne Gott kann es außerdem keinen freien Willen geben. Würde man nämlich einer rein materialistischen Weltsicht folgen, wäre unser Verhalten biologisch und chemisch determiniert. Sowohl unsere grundgesetzliche Leitidee der Menschenwürde als auch unser Straf- und Privatrecht, das auf dem Schuldgrundsatz beziehungsweise auf dem Prinzip der Privatautonomie beruht, gehen aber von der Prämisse aus, dass es eine menschliche Entscheidungsfreiheit gibt.
Der christliche Glaube gibt zudem Antworten auf zentrale Fragen des Menschen: Warum gibt es uns und warum gibt es nicht nichts? Was ist der Sinn des Lebens? Wie sollen wir leben? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Der Atheismus hat auf diese Fragen hingegen nicht nur keine überzeugenden Antworten, sondern kann nicht einmal erklären, warum wir Menschen diese Fragen überhaupt haben. Woher kommt beispielsweise unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit? Nur wenn es einen Gott gibt, nur wenn die Erschaffung der Welt einen geistigen Grund hat, kann das Leben letztlich einen Sinn haben.
Und nur wenn es einen Gott gibt, kann es auch Gerechtigkeit geben, wo weltliche Gerechtigkeit versagt. Denn nur wenn es einen Gott gibt, gibt es eine Instanz, gegenüber der jeder Mensch verantwortlich ist. Von einer solchen Verantwortung geht auch das Grundgesetz aus, das sich das deutsche Volk „im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen“ gegeben hat. Der Glaube an eine solche Verantwortung und Gerechtigkeit hilft uns überdies mit den Ungerechtigkeiten dieser Welt zurechtzukommen. Auch der Auschwitz-Überlebende Alex Deutsch (1913-2011) vertraute auf diese Gerechtigkeit und fand so seinen Frieden und die Kraft, nach seiner Befreiung ein neues Leben zu gestalten.
Religion hat außerdem den Vorteil, dass sie Ethik begründen kann. Zwar gibt es natürlich gläubige Menschen, die sich unmoralisch verhalten und Atheisten, die sehr anständige Menschen sind. Jeder Mensch, der sein Gewissen befragt, kann nämlich erforschen, ob etwas Recht oder Unrecht ist. Denn die „Forderung des Gesetzes“ ist jedem „ins Herz geschrieben“; das „Gewissen legt Zeugnis davon ab“ (Römer 2,15). Dennoch gibt es auch Atheisten wie den Linke-Politiker Gregor Gysi, die „eine gottlose Gesellschaft“ fürchten. Denn wenn es keinen Gott gibt, ist zwar noch nicht „alles erlaubt“, wie der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski (1821-1881) meinte. Aber letztlich gilt dann kein Wert mehr absolut und alles gerät in die Gefahr, zur Disposition gestellt zu werden – entweder zur Disposition der Mehrheit und/oder zur Disposition der Mächtigeren. Alles gerät unter einen Nützlichkeitsvorbehalt. Wahrheit und Gerechtigkeit zählen dann nicht mehr, „Macht ist dann das einzige Prinzip“, wie einst Papst Benedikt XVI. (1927-2022) schrieb.
Richard Dawkins spricht sich hingegen für einen „rationalen säkularen Humanismus“ und „Moralphilosophie“ als „Ersatz“ für das Christentum aus. Wir sollten auf der Grundlage säkularer Moralphilosophie entscheiden, welche Teile des Christentums uns gefallen und was moralisch ist – und was nicht. „Cherry-picking“ nennt Dawkins das. Das mag auf den ersten Blick gut klingen, ein näherer Blick zeigt aber, dass Dawkins mit seiner säkularen Moral genau das meint, wovor Benedikt XVI. warnte: Der Stärkere entscheidet anhand eigener Nützlichkeitserwägungen, was moralisch ist. So bezeichnete der Engländer es einst als „unmoralisch“ (!), ein Kind mit Down-Syndrom auf die Welt zu bringen, wenn man es abtreiben könne. Eine Abtreibung sei auch zum Wohl des Kindes (!) angezeigt. Seine Philosophie basiere auf dem Wunsch, Glück zu mehren und Leid zu verringern. Ähnliche utilitaristischen Überlegungen und menschenverachtenden Kosten-Nutzen-Rechnungen hatten bereits die Nazis angestellt: „Erbkranke fallen dem Volk zur Last.“
Im Übrigen gibt es nicht nur religiöse Wahrheiten, die Menschen für wahr halten, obwohl man sie nicht beweisen kann. So reklamiert beispielsweise unser Grundgesetz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Aber haben Sie schon mal Menschenwürde gesehen? Lässt es sich beweisen, dass jeder Mensch gleich an Würde ist oder bestimmte unveräußerliche Rechte hat? Nein. Es handelt sich bei dem Menschenwürdepostulat um ein „Axiom“ – das heißt, etwas, was wir als richtig erkannt haben und als selbstverständliche Wahrheit anerkennen.
Und so verfasste schon Thomas Jefferson (1743-1826) die in der US-Unabhängigkeitserklärung verewigten, wirkmächtigsten Worte der amerikanischen Geschichte: „Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich erschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören.“ Solche Wahrheiten lassen sich nicht biologisch-naturwissenschaftlich begründen; die US-Gründerväter übernahmen die Idee der Gleichheit aus dem Christentum, wie auch der israelische Historiker Yuval Noah Harari schreibt.
Andere Größen der US-Geschichte beriefen sich später auf dieses „Glaubensbekenntnis“: Zum einen beispielsweise Präsident Abraham Lincoln (1809-1865) – der den Bestand der Union bewahrte und das Ende der Sklaverei durchsetze – in seiner historischen „Gettysburg Address“. Zum anderen der Baptisten-Pastor Martin Luther King Jr. (1929-1968), der in seiner berühmten „I have a dream“-Rede, die USA dazu aufrief, „die wahre Bedeutung ihres Glaubensbekenntnisses“ zu verwirklichen. Wie die Abolitionismus-Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei im 18. und 19. Jahrhundert war auch die US-Bürgerrechtsbewegung stark von christlichen und aufklärerischen Überzeugungen geprägt. Beide Bewegungen sind – wie auch christliche Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus oder die Entwicklungen, die zum Fall des Eisernen Vorhangs führten – eindrucksvolle Beispiele dafür, welche Kraft der christliche Glaube entwickeln kann.
Kultur-Christentum ist nicht genug
Ein reines Kultur-Christentum verliert jedoch seine kulturprägende Kraft. Es verliert seine Kraft, Schönes und Gutes hervorzubringen. 632 Jahre Bauzeit benötigte der Kölner Dom. Hätten die Erbauer des Doms jemals mit dem Bau begonnen, wenn sie nicht gläubig gewesen wären? Hätte sich der heilige Pater Maximilian Kolbe (1894-1941) in Auschwitz im Austausch für einen Familienvater in die Todeszelle sperren lassen, wenn er nicht an Jesus Christus und ein Leben nach dem Tod geglaubt hätte?
Dawkins freut sich einerseits darüber, dass die Zahl gläubiger Christen in Großbritannien zurückgeht, befürchtet andererseits aber den Verlust christlicher Kultur und Kirchen, obwohl beide Phänomene – Glaube und Kultur – miteinander zusammenhängen und nicht voneinander zu trennen sind. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron bezeichnete die im letzten Jahr glanzvoll wiedereröffnete Pariser Kathedrale Notre-Dame als „das Herz von Paris“ und „die Seele Frankreichs“. Das, was Notre-Dame zur Seele Frankreichs macht, kann nicht das Gebäude als solches sein (etwas Materielles), da man mit „Seele“ etwas Immaterielles meint. Das, was Notre-Dame ausmacht und „beseelt“, ist der Glaube der Menschen, der Frankreich und unsere europäische Kultur über Jahrhunderte geprägt hat und der sich in den Steinen und Fenstern der Pariser Kathedrale manifestiert. Wenn Kirchen aufhören, für ihre Bestimmung genutzt zu werden, wenn in ihnen keine Menschen mehr beten und Gottesdienst feiern, werden sie profaniert. Einige bleiben als Museen erhalten, andere Kirchen verfallen. Aber in jedem Fall verlieren sie ihre Seele.
Nach dem sogenannten Böckenförde-Diktum des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Ernst-Wolfgang Böckenförde (1930-2019) lebt der „freiheitliche, säkularisierte Staat (…) von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“. Unsere Gesellschaft braucht ein geistiges Fundament. Unsere Gesellschaft gründet auf christlichen Wurzeln. Wer das – wie Dawkins – erkannt hat und unsere kulturellen Errungenschaften schätzt, kann sich über ein Absterben unserer Wurzeln nicht freuen, sondern muss dies als Gefahr sehen. Denn kein Baum kann blühen, wenn seine Wurzeln kaputtgehen.
Dies hat auch die niederländisch-amerikanische Frauenrechtlerin Ayaan Hirsi Ali erkannt, die vormals eine gläubige Muslimin und dann über zwei Jahrzehnte eine der bekanntesten Atheistinnen der Welt war und im Übrigen auch eine Freundin von Richard Dawkins ist. Nachdem die gebürtige Somalierin ein Jahrzehnt lang an Depressionen gelitten hatte, fand sie über Gebete den Weg zum christlichen Glauben und gewann ihre Lebensfreude zurück: Ein Leben ohne spirituellen Trost hält sie für unerträglich. In einem Aufsatz legte sie vor anderthalb Jahren neben diesem persönlichen Grund einen weiteren Grund für ihre Konversion zum Christentum dar. Sie sieht die Errungenschaften der westlichen Zivilisation durch den globalen Islamismus, die Woke-Ideologie sowie Autoritarismus und expansionistisches Großmachtstreben in Gefahr.
Wie eingangs bereits geschrieben wurde, fürchtet Dawkins eine Welt, in der wir das Christentum durch eine andere Religion ersetzen würden. Aber „Religion“ verschwindet nicht, wie beispielsweise der Bonner Soziologie-Professor Clemens Albrecht anmerkt: Denn wenn ein alter Glaube verschwindet, rückt ein neuer an seine Stelle. Hirsi Ali schreibt, atheistische Aktivisten hätten geglaubt, dass wir ohne Gott ein Zeitalter der Vernunft und des Humanismus einläuten würden. Doch die moralische Lücke, die eine sich zurückziehende Kirche hinterlassen habe, sei lediglich durch einen Wirrwarr irrationaler quasi-religiöser Glaubenssätze gefüllt worden. So habe schon G. K. Chesterton (1874-1936) gewarnt: „Wenn Menschen sich dafür entscheiden, nicht an Gott zu glauben, glauben sie danach nicht an nichts, sondern sind dann in der Lage, an alles zu glauben.“
Hirsi Ali hält den Atheismus für zu schwach und spaltend, um Errungenschaften der westlichen Zivilisation zu verteidigen. Es brauche die Kraft einer einigenden Geschichte, um die Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen. Man müsse den Menschen etwas bieten, das ihnen Bedeutung und Sinn gibt. Das alles biete das Christentum.
Kein Christentum ohne Ostern
Ohne Ostern gäbe es kein Christentum. An Ostern feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Doch ist Jesus wahrhaftig auferstanden? Das ist nicht leicht zu glauben – es wäre schließlich ein Wunder.
Die Apostel waren davon überzeugt, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist. Elf der zwölf Apostel sind der Überlieferung nach für ihren Glauben den Märtyrertod gestorben: Simon Petrus, Andreas und Philippus wurden gekreuzigt, Judas-Ersatzmann Matthias wurde gesteinigt, Jakobus der Ältere wurde mit dem Schwert hingerichtet, Jakobus der Jüngere wurde mit einem Knüppel und Thaddäus mit einer Keule erschlagen, Matthäus wurde wohl in Äthiopien getötet, Thomas wurde in Indien mit einem Speer niedergestochen und Simon soll zersägt und Bartholomäus bei lebendigem Leib die Haut abgezogen worden sein.
Es gibt nicht viele Menschen, die bereit wären, für eine Wahrheit, an die sie glauben, zu sterben. Aber jemanden, der bereit wäre, für eine Lüge zu sterben, kenne ich nicht.
Siehe: „The Victory of Reason – How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and Western Success“, Rodney Stark; „Der Skandal der Skandale – Die geheime Geschichte des Christentums“, Manfred Lütz; „Sapiens – A Brief History of Humankind”, Yuval Noah Harari; „Herrschaft: Die Entstehung des Westens”, Tom Holland