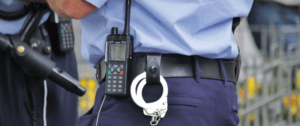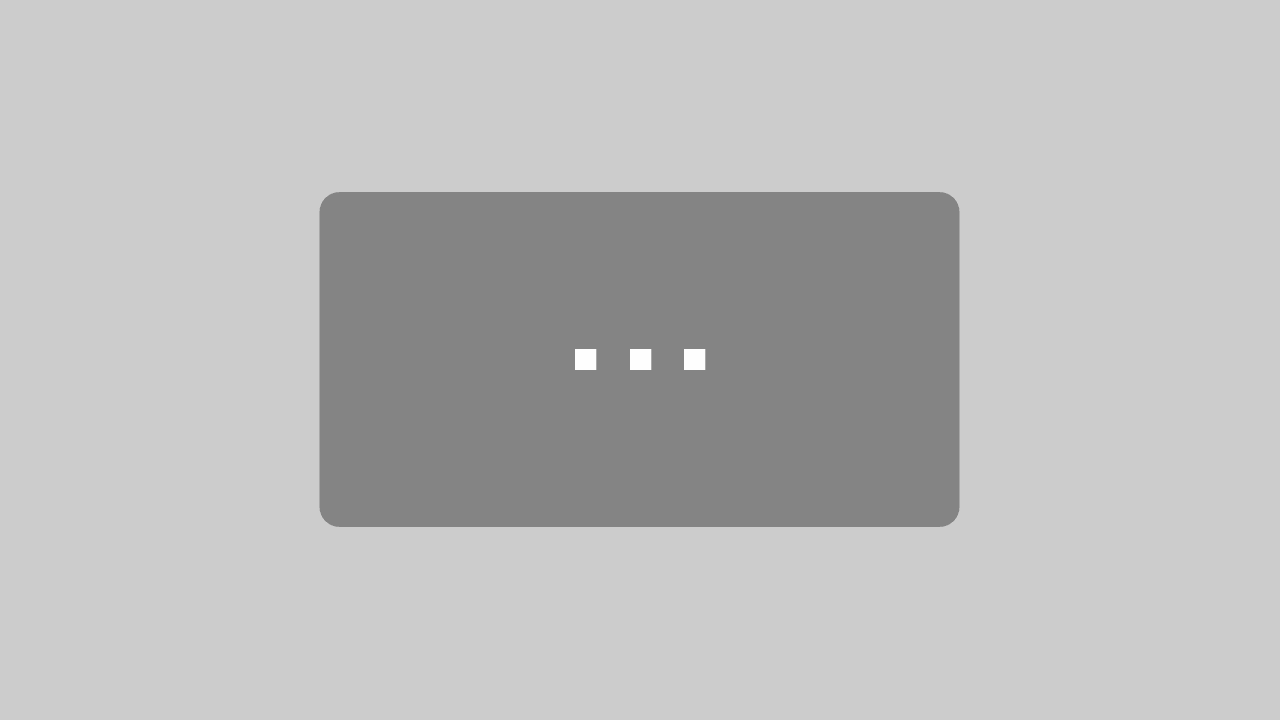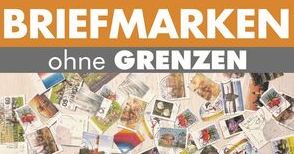Es war ein historischer Moment für die saarländische Stahlindustrie. Im Oktober 2024 verkündete die Unternehmensleitung der DHS-Gruppe die Umstellung der saarländischen Stahlerzeugung auf „grünen Stahl“. Das traditionelle Hochofenverfahren, welches Eisenerz mit Hilfe von Kokskohle reduziert, soll am Ende dieser Dekade abgelöst werden durch einen sog. Direktreduktionsprozess, bei dem Erdgas und perspektivisch sog. „grüner Wasserstoff“ die Reduktion des Eisenerzes vornehmen und somit die CO2 -Emission deutlich reduzieren bzw. komplett vermeiden sollen. In ungewöhnlicher Einigkeit betonten die Unternehmensführung, die saarländische Landesregierung, Betriebsrat und Gewerkschaften, dass mit dieser Transformation die Zukunft des Stahlstandorts Saarland gerettet sei. Aber ist dem so? Im Folgenden sollen die ökonomischen Grundlagen etwas genauer beleuchtet werden.
Für grünen Stahl wird viel Strom benötigt
Betrachtet man sich die Kosten dieser Transformation, so sind natürlich zuerst die anfallenden Investitionskosten zu betrachten. Diese betragen ca. 4,6 Mrd. €, von denen der Bund und das Land 2,6 Mrd. übernehmen. Insgesamt sind 7 Mrd. € an Subventionen für die Stahlindustrie in ganz Deutschland geplant. Das ist kein geringer Betrag und er wirft die Frage auf, ob das Verfahren künftig wirtschaftlich tragfähig sein wird und so die Zukunftsfähigkeit der saarländischen Stahlindustrie garantieren kann. Hier treten aber zwei Probleme auf: Es werden hohe Mengen an Strom und grünem Wasserstoff benötigt – beides wirft Sorgenfalten auf.
Beginnen wir erst einmal mit dem Stromproblem: Nach Unternehmensangaben werden die geplanten Anlagen den Strombedarf des Saarlandes verdoppeln. DHS-Chef Rauber forderte, dass diese dem Unternehmen zu einem Preis von 4 ct/kWh zur Verfügung gestellt werden sollen, aktuell bezahle DHS 12 ct/kWh für seinen Strom. Hier kann man einmal rechnen: Eine Verdopplung des Strombedarfs des Saarlands entspricht ungefähr acht zusätzlichen Milliarden Kilowattstunden im Jahr. Das ist keine vernachlässigbare Menge. Die Energiestrategie der jetzigen wie auch der wahrscheinlich neuen Bundesregierung setzt darauf, dass wir künftig unseren Strombedarf ausschließlich aus Wind- und Solaranlagen bedienen sollen. Um jedes Jahr zusätzliche 8 Mrd. kWh produzieren zu können, müssten jedoch rechnerisch ca. 800 Windkraftanlagen der neuesten Bauart im Saarland installiert werden – wo man so viele dieser 250 Meter hohen Anlagen im dicht besiedelten Saarland hinstellen soll, ist doch sehr die Frage. Zusätzlich haben Windkraft- wie auch Solaranlagen das Grundproblem, dass sie nicht zeitlich verlässlich Strom liefern. Es treten immer wieder sog. Dunkelflauten auf, in denen beide wenig bis gar keinen Strom liefern. Um in Dillingen einen kontinuierlichen Produktionsbetrieb aufrechtzuerhalten, braucht man also zusätzlich sog. Backup-Kraftwerke, die wetterunabhängig liefern können. Ein Zusatzbedarf von 8 Mrd. kWh pro Jahr entspricht drei Gaskraftwerken, die man ausschließlich für die Stahlindustrie benötigen wird. Dies alles wird Stromkosten nach sich ziehen, die weit über 10 ct/kWh liegen werden. Es wird also notwendig sein, dass der Staat die Stromkosten senkt. Eine Perspektive auf günstigere Strompreise ist kaum zu sehen – sie werden auf Sicht der nächsten 10 Jahre eher zunehmen, wofür die hohen Netzkosten verantwortlich sind, die durch den Ausbau der sog. Erneuerbaren auf uns zukommen. Der Subventionsbedarf für den hohen Stromverbrauch der saarländischen Stahlindustrie wird also dauerhaft sein.
Grüner Wasserstoff – die große Unbekannte
Es ist die große Vision – Eisenerz wird künftig ausschließlich mit sog. grünem Wasserstoff reduziert, der mit Hilfe von Solar- und Windkraftanlagen gewonnen wird. Leider mussten wir in den letzten zwei Jahren beobachten, dass uns ständig Meldungen über abgesagte Projekte erreichten. Ein wichtiger Rückschlag war dabei die im November 2024 eingetretene Insolvenz des „Vorzeigeunternehmens“ HH2E, welches zuvor versprach, grünen Wasserstoff in großer Menge für industrielle Abnehmer wie die Stahlindustrie herzustellen. Auf Sicht von 2030 scheidet eine Versorgung der Stahlindustrie mit „heimischem“ grünem Wasserstoff aus – eine alternative Strategie von Herrn Habeck bestand darin, aus Erdgas gewonnenen Wasserstoff aus Norwegen zu beziehen. Diese wurde jedoch von Seiten Norwegens wegen erheblicher Zweifel an der wirtschaftlichen Tragfähigkeit abgesagt. So bleibt hinter der Beschaffung der benötigten Wasserstoffmengen nicht nur kurzfristig ein großes Fragzeichen. Dies reflektiert sich auch in den Marktpreisen: So ist grüner Wasserstoff zurzeit am Markt etwa fünf- bis sechsmal so teuer wie Erdgas und Prognosen gehen davon aus, dass wir auch im Jahr 2030 bei mindestens dem dreifachen Preis liegen werden. Die Vision von grünem Wasserstoff hat keine wirtschaftliche Grundlage.
Dies hat offenbar auch die noch amtierende Bundesregierung eingesehen – so hat Bundeskanzler Scholz zuletzt gegenüber der Saarbrücker Zeitung ins Spiel gebracht , dass französische Kernkraftwerke den benötigten Wasserstoff für die saarländische Stahlindustrie erzeugen könnten. Dieser Vorschlag entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Ausgerechnet die Regierung, die die letzten deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet hat, denkt nun in der Notsituation über Kernkraftstrom unserer Nachbarn nach. Und hierbei muss man ja bedenken, dass wir durch die Abschaltung unserer Kernkraftwerke ohnehin von französischen Stromimporten abhängig geworden sind – wir haben im Jahr 2024 eine Rekordmenge von 13 Mrd. kWh netto importieren müssen. Diese Mengen immer weiter zu erhöhen, sei es für den Strombedarf oder für die Produktion von Wasserstoff, kann Deutschland zwar anstreben, aber möglicherweise hat Frankreich andere Pläne. So hat Präsident Macron vor kurzem angekündigt, dass er das französische Überangebot an Strom in der Zukunft dazu nutzen will, Frankreich zu einem Zentrum der künstlichen Intelligenz machen – für deren Rechenzentren werden große Strommengen benötigt. Dies wird uns in Probleme bringen, die jedoch nicht sein müssten: Wir könnten auf heutigem Stand immer noch die zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke ans Netz zurückholen: Allein Neckarwestheim-2 hat ca. 11 Mrd. kWh pro Jahr geliefert – CO2-neutral, verlässlich und vor allem günstig. Mit diesen Anlagen hätte man den von Herrn Rauber geforderten Preisbereich von bis zu 4 ct/kWh erreichen können. Leider war gerade von der energieintensiven Industrie wenig Widerstand gegen die Abschaltung dieser Anlagen zu vernehmen – nach Subventionen zu rufen ist wohl einfacher.
Die Perspektive? Ein Dauersubventionsprodukt entsteht
Was bleibt? Es wird künftig an der Saar Stahl hergestellt, der auf absehbare Zeit nicht marktfähig sein wird. Der derzeitige Weg besteht darin, dass der Staat die Kosten mit Subventionen drückt – für diese ist derzeit aber keine zeitliche Begrenzung in Sicht. Eine weitere Scheinlösung besteht in der Idee „grüner Leitmärkte“, die auch im Sondierungspapier der derzeitigen Koalitionsverhandlungen auftaucht. Diese bedeuten, dass Stahlabnehmer, also bspw. die Automobilindustrie, gezwungen werden sollen, bestimmte Quoten an grünem Stahl zu kaufen. Dies wird aber deren Kosten nach oben treiben und somit den Abwanderungsdruck der deutschen Industrie weiter erhöhen. In Summe wird dies also die wirtschaftlichen Probleme unseres Landes weiter erhöhen – und der Staat wird sich nicht auf Dauer immer weiter verschulden können. Diese Rechnung wird irgendwann bezahlt werden müssen.
Dr. Canne spricht am Donnerstag, den 27. März, um 18 Uhr in einem Vortrag in Hasborn-Dautweiler zum Thema
Sorgen um Deutschlands Stromversorgung – wie groß ist die Gefahr von Mangelzuständen?
Die Kolumne spiegelt nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.