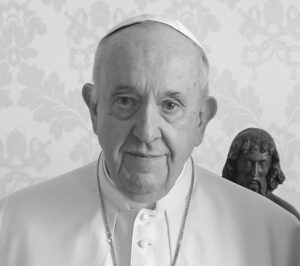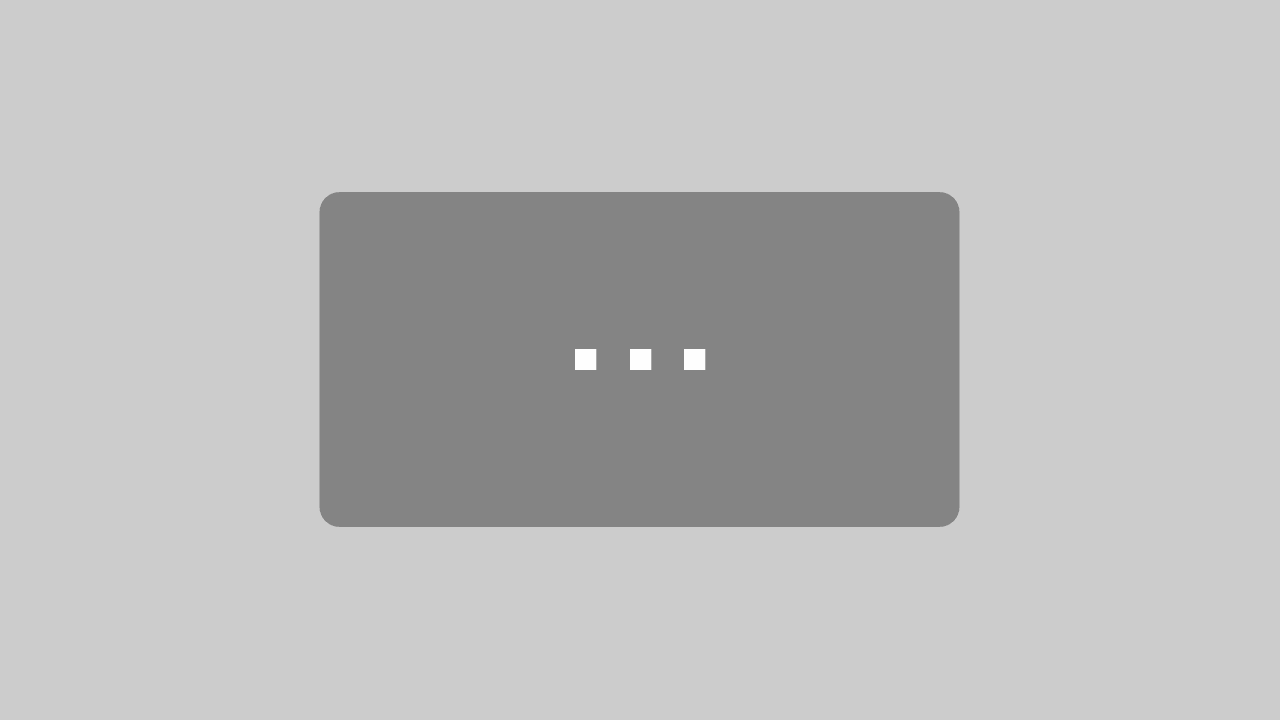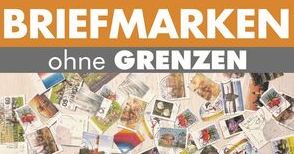Deutschland hat gewählt und das Wahlergebnis ist eines, das vor wenigen Monaten wohl fast niemand für möglich gehalten hätte. Aus einem anfänglichen Duell zwischen CDU/CSU und Grünen wurde ein Duell zwischen CDU/CSU und SPD, das die Sozialdemokraten mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz am Sonntag gewonnen haben. Mit 25,7 Prozent liegt die SPD knapp, aber deutlich vor der Union mit Armin Laschet (24,1 Prozent). Zu einem „Wimpernschlag-Finale“ kam es nicht. Die Grünen landen mit ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock abgeschlagen auf Platz 3 (14,8 Prozent). Dahinter folgen FDP, AfD und Linke.
SCHLECHTESTES UNIONSERGEBNIS DER GESCHICHTE
Für die Union ist es das mit Abstand schlechteste Bundestagswahlergebnis der Geschichte: bei der ersten Bundestagswahl 1949 hatte die Union 31,0 Prozent erreicht. Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 hatte die Union bereits mit 32,9 Prozent das bis dato zweitschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Im Vergleich zu 2017 büßten CDU/CSU nochmals 8,8 Prozentpunkte ein – ebenfalls ein Unions-Negativ-Rekord. Und nach 25 Wahlsiegen bei bundesweiten Wahlen liegen die Christdemokraten erst zum vierten Mal (nach den Bundestagswahlen von 1972, 1998 und 2002) nur auf Platz 2 hinter der SPD.
Besonders schlechtes Unionsergebnis im Saarland
Besonders desaströs ist das CDU-Ergebnis im Saarland. Die CDU erreichte dort nur 23,6 Prozent (- 8,8 Prozentpunkte), die SPD hingegen 37,3 Prozent (+ 10,1 Prozentpunkte). Die Union verlor zudem alle vier Wahlkreise an die SPD. 2017 hatte die Union noch die Wahlkreise Saarlouis (Peter Altmaier gegen Heiko Maas), Homburg (Markus Uhl gegen Esra Limbacher) und St. Wendel (Nadine Schön gegen Christian Petry) für sich entscheiden können. Bei den Zweitstimmen lag die Union zudem in allen 52 saarländischen Kommunen hinter der SPD. Sogar in Tholey – der CDU-Hochburg des Saarlandes, in der die CDU bei Kommunalwahlen regelmäßig mehr als 60 Prozent erreicht – lag die SPD bei dieser Bundestagswahl sechs Wählerstimmen vor der CDU.
DOCH WAS SIND DIE GRÜNDE FÜR DAS WAHLDESASTER DER UNION?
So wie der Erfolg sprichwörtlich viele Väter hat, hat auch der Misserfolg viele Väter (und eine „Mutti“).
1. Kandidatenkür und fehlende Geschlossenheit
Jeder politische Beobachter weiß: Wähler mögen keinen parteiinternen Streit. Geschlossenheit war daher immer ein Erfolgsgarant des christdemokratischen „Kanzlerwahlvereins“, nicht jedoch bei dieser Wahl. Der Kür von CDU-Chef Armin Laschet zum Unions-Kanzlerkandidaten ging im April ein mehrtägiger und auf offener Bühne ausgetragener Machtkampf zwischen Laschet und CSU-Chef Söder voraus. Und auch nachdem der CDU-Bundesvorstand den Machtkampf zugunsten des NRW-Ministerpräsidenten Laschet entschieden hatte, waren insbesondere aus Bayern immer wieder Zeichen fehlender Geschlossenheit zu vernehmen. So bezeichnete CSU-Generalsekretär Blume Markus Söder nach Laschets Kür als den „Kandidaten der Herzen“ und Söder übte mehrmals öffentlich Kritik an Laschets Wahlkampf.
Will die Union wieder schnell an alte Wahlerfolge anknüpfen, muss sie künftig wieder geschlossen als eine Union auftreten. Zudem darf sich so ein Theater wie im April nicht wiederholen. Es sollte daher zudem vereinbart werden, wie man im Falle einer Uneinigkeit zwischen den Vorsitzenden von CDU und CSU einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten bestimmen will.
2. Der Kanzlerkandidat
Bei Bundestagswahlen wählt das Volk zwar eigentlich Parteien und keinen Kanzler. In der Praxis entscheiden sich aber viele Wähler nach Gefühl und wegen der Kandidaten für eine Partei. Daher ist der Spitzenkandidat von herausragender Wichtigkeit. Wenn eine Partei bei Wahlen erfolgreich sein will, muss sie Inhalte mit Persönlichkeiten verknüpfen, denen die Bürger vertrauen und die sie sich als Vertreter ihrer Interessen wünschen. Die SPD hat mit ihrem Kandidaten Scholz das Maximum herausgeholt: 50 Prozent der SPD-Wähler hätten laut einer ARD-Umfrage ohne Scholz gar nicht SPD gewählt.
Laschet war hingegen alles andere als ein Zugpferd. Im Januar war er, obwohl er bei zahlreichen Umfragen bei CDU-Mitgliedern, CDU-Anhängern und Bürgern weit hinter seinen Konkurrenten Merz und Röttgen gelegen hatte, von den 1.001 Delegierten des Bundesparteitags zum neuen CDU-Chef gewählt worden. Im April drückte der CDU-Bundesvorstand dann Laschet als Kanzlerkandidaten durch, obwohl CSU-Chef Söder wiederum deutlich höhere Zustimmungswerte hatte. Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts Forsa zu Folge hätte die Union mit Söder als Kanzlerkandidat über 30 Prozent der Stimmen erhalten.
Dass Laschet zweimal gegen den offenkundigen Wunsch einer großen Mehrheit der CDU-Mitglieder und CDU-Anhänger „durchgedrückt“ wurde – erst durch den Bundesparteitag und dann durch den Bundesvorstand – hat viele Mitglieder und Wähler verärgert und demotiviert. Jeder kennt wahrscheinlich der Union nahestehende Wähler und sogar Mitglieder, die ihr Kreuz bei dieser Wahl deswegen woanders machten.
Für Laschet als Kanzlerkandidaten gab es sicher auch viele gute Gründe: Seine große, mehr als 30-jährige politische Erfahrung als Mitglied von Stadtrat, Landtag, Bundestag und Europaparlament. Seine Bürgernähe und Gelassenheit. Seine Fähigkeit Menschen und unterschiedliche Parteiströmungen zusammenzuführen. Seine erfolgreiche und geräuschlose Arbeit als NRW-Ministerpräsident mit einer 1-Stimmen-Mehrheit.
Nach 16 Jahren CDU-Kanzlerschaft war aber ein erneuter Wahlsieg alles andere als selbstverständlich. Angesichts der geringen politischen Unterschiede zwischen Laschet und Söder hätten die Erfolgsaussichten beider Kandidaturen das ausschlaggebende Kriterium sein müssen. Und diesbezüglich sprach alles für Söder.
Es war daher ein großes Risiko und letztendlich ein Fehler, trotz seiner relativ schlechten Zustimmungswerte auf Laschet zu setzen. Es war eine arrogante Haltung des Bundesvorstands, zu glauben, dass die Union die Wahl sowieso gewinnen würde. Der Bundesvorstand sollte dafür die Verantwortung übernehmen und geschlossen zurücktreten, soweit es nicht doch noch zu einer CDU-geführten Jamaika-Koalition kommen sollte.
Für die Zukunft sollte bei der Wahl des CDU-Chefs und evtl. auch bei der Kür der Kanzlerkandidaten die Möglichkeit eröffnet werden, Mitglieder mehr einzubinden. Es ist nicht mehr zeitgemäß, die Wahl des Vorsitzenden in jedem Fall nur auf die Delegierten des Bundesparteitages zu beschränken (der sich weitgehend aus Berufspolitikern zusammensetzt). Es sind einfache Parteimitglieder, die nachher den Wahlkampf machen, die Mitbürger überzeugen sollen. Diesen Mitgliedern ist auch eine solche Wahlentscheidung zuzutrauen.
3. Themensetzung: Markenkern und Zukunftskompetenz
Ein weiterer gewichtiger Grund für das schlechte Unionswahlergebnis war zudem, dass es der Union nicht erfolgreich gelungen ist, Themen zu besetzen. Dieses Manko wurzelt schon in den schlecht geführten Koalitionsverhandlungen mit der SPD nach der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017. Unter dem Druck der SPD-Mitgliederbefragung und der Angst vor einem möglichen Scheitern der Koalitionsverhandlungen hatte man damals der SPD beinahe alle interessanten Ministerien überlassen: So gingen u.a. Außen, Finanzen, Arbeit und Soziales, Umwelt und Justiz an die SPD. Und die Ministerien, die die Union bekam, wurden zum Großteil nicht mit herausragenden Politiker-Persönlichkeiten besetzt: Niemand wählt Union, damit Anja Karliczek, Helge Braun, Annette Widmann-Mauz, Andreas Scheuer oder Julia Klöckner im Amt bleiben.
Die Union hätte damals und jetzt im Wahlkampf klassische CDU-Themen (wie innere und äußere Sicherheit, solide Finanzpolitik usw.) und auch Zukunftsthemen (wie Klimaschutz, Digitalisierung und Demographischer Wandel) mit guten, bekannten und populären Köpfen besetzen und mit diesem Team im Wahlkampf auch werben müssen.
Adenauer hatte beispielsweise einen Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, der für soziale Marktwirtschaft und „Wohlstand für alle“ stand, Bundeskanzler Kohl einen Arbeitsminister Norbert Blüm, der für soziale Gerechtigkeit und sichere Renten stand („Die Rente ist sicher“) oder einen Umweltminister Klaus Töpfer, mit dem ältere Leute noch heute Umwelt- und Klimaschutz verbinden.
Die Union hatte dieses Mal hingegen beispielsweise keine Person im Aufgebot, mit der die Leute die „schwarze Null“ verbinden konnten (Finanzminister ist Scholz) oder „Law and Order“ (Innenminister Seehofer hört nach der Wahl auf) oder erfolgreiche Digitalisierung (kein Normalbürger kennt Dorothee Bär) oder starken und innovativen Klimaschutz. Wer erinnert sich noch an Barbara Hendricks? Wer kennt Svenja Schulz? Oder hieß sie Schulze? Klimaschutz ist das Mega-Thema unserer Zeit, da kann man das Umweltministerium nicht irgendwelchen SPD-No-Names überlassen.
Angela Merkel war eine gute Kanzlerin, die Deutschland insgesamt mit Maß und Mitte regiert hat und als „chancellor of the free world“ große internationale Reputation hatte. Unter ihrer Führung hatte Deutschland erfolgreiche Jahre mit Rekordbeschäftigung, starkem Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Finanzpolitik. Ein Talent dafür, hoffungsvolle Politiker um sich zu scharen, hatte sie leider nicht. Es ist kein Zufall, dass sämtliche ihrer Nachfolgekandidaten entweder in den Ländern Karriere machten (wie Laschet, Kramp-Karrenbauer und Söder) oder von Merkel geschasst worden waren (wie Merz und Röttgen).
4. Die Ausgangslage und sonstige Gründe
Ein weiterer Grund für das schlechte Unionsergebnis war u.a. die schwierige Ausgangslage. Nach 16 Jahren Regierungszeit ist es schwer, einen neuen Aufbruch zu verkörpern. Die Unzulänglichkeiten und Versäumnisse werden einem angerechnet, ohne dass man auf der Gegenseite weiter vom Kanzlerbonus profitieren könnte. Vereinzelt dürften auch die Maskendeals einzelner Abgeordneter sowie eine in Teilen zu strenge Corona-Politik Stimmen gekostet haben.
5. Saarlandspezifische Gründe
Für das besonders schlechte Abschneiden der CDU im Saarland gibt es nochmal spezifische Gründe: Die SPD profitierte zum einen von dem katastrophalen Auftreten und schlechten Abschneiden der Saar-Linken, zu deren Nicht-Wahl Linken-Ikone Oskar Lafontaine aufgerufen hatte. Zum anderen kam der SPD wohl zugute, dass die Grünen im Saarland bei dieser Wahl nicht wählbar waren, nachdem deren undemokratisch aufgestellte Landesliste zu Recht vom Bundeswahlausschuss abgelehnt worden war.
WIE GEHT ES JETZT WEITER?
Trotz des vergleichsweise schlechten Unionsergebnisses ist aber weiterhin offen, wer die nächste Bundesregierung führt. Die stärkste Fraktion stellt nicht automatisch den Kanzler. Dass SPD-Chef Norbert Walter-Borjans der Union das „moralische Recht“ abspricht, nach dieser Wahl den Kanzler zu stellen, ist mit Blick auf die SPD-Geschichte verwunderlich. SPD-Ikone Willy Brandt wurde 1969 trotz eines 46 Prozent-Wahlsiegs der Union (ein Ergebnis, das die SPD bei deutschlandweiten Parlamentswahlen in 150 Jahren nie erreichen konnte) Kanzler – und das auch noch mit dem Slogan „Mehr Demokratie wagen“. Und Helmut Schmidt war acht Jahre Kanzler (und damit länger als jeder andere Sozialdemokrat), ohne die SPD jemals zu einem Wahlsieg geführt zu haben.
„Ampel“ am wahrscheinlichsten
Kanzler wird, wer von einer Mehrheit der Mitglieder des Bundestages zum Bundeskanzler gewählt wird. Entscheidend ist, wem es gelingt, eine Koalition zu bilden. Am wahrscheinlichsten ist zurzeit ein sog. „Ampel-Bündnis“ aus SPD, Grünen und FDP. Angesichts der Gräben zwischen Rot-Grün und Liberalen bestehen aber hohe Hürden für eine Ampel-Koalition. FDP-Chef Christian Linder dürfte nicht der einzige sein, dem derzeit die Fantasie für einen Koalitionsvertag fehlt, dem die linke SPD-Basis und die FDP zustimmen können.
„Jamaika“ möglich
Möglich ist auch eine „Jamaika-Koalition“ aus Union, Grünen und FDP. Personell wie inhaltlich ist ein erfolgreiches Bündnis denkbar. Die Union sollte versuchen, diese Chance zu nutzen, wobei Armin Laschet mit dem hauptsächlich von ihm zu verantwortenden Wahlergebnis der Bevölkerung kaum als Kanzler zu vermitteln sein wird. Eine Jamaika-Koalition wäre grundsätzlich besser für Deutschland und die Partei. Denn ein in Wiedererstarken in der Opposition ist genauso wenig programmiert wie ein Wiederaufstieg des HSV. Es darf jedoch kein „Regieren um jeden Preis“ geben. Wenn die Union regiert, muss dies programmatisch auch erkennbar sein.
Der Beitrag gibt die Meinung der Autoren wieder. Die Autoren sind beide Mitglieder der Jungen Union Saar und der CDU (Christian Funck) bzw. CSU (Thomas Funck).